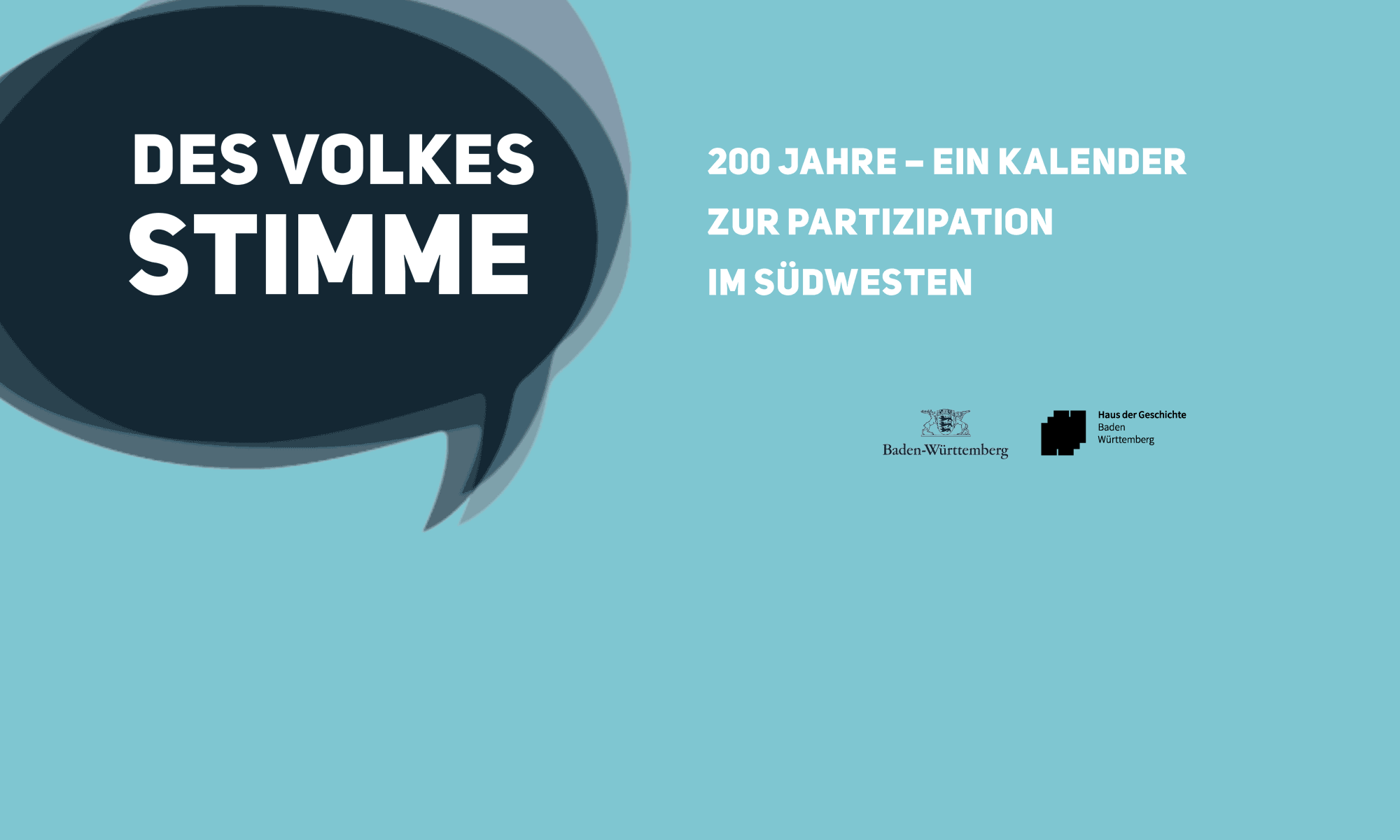5. Februar 1865 | Hier kann das Landesglücksspielgesetz (LGlüG) nicht weiterhelfen. Den Begriff „Wandernde Kasinos“ kennt es nicht. Und dies liegt nicht nur an der Schreibweise. Kein Wunder, denn die ursprüngliche Idee dazu stammt aus dem 19. Jahrhundert. Auf dem Katholikentag in Aachen 1862 wurden die Gläubigen dazu aufgerufen, „Kasinos“ zu gründen. Nein, die Kirche wollte sie nicht zum Glücksspiel verleiten. Casinogesellschaften galten seit der Französischen Revolution als Orte, an denen Männer des Bürgertums Freizeitvergnügen und politische Diskussion gepflegt miteinander verbinden konnten. Und genau dies sollten die neuen „Kasinos“ nun speziell auch für ein katholisches Publikum leisten – und damit ein politisches Zeichen setzen.

Der am 10. Mai 1833 in Heidelberg geborene Kaufmann Jakob Lindau war einer der Männer, die diese Idee aufgriffen. In seiner Heimatstadt gründete er im Herbst 1862 ein Kasino, das jeweils mittwochs im „Pariser Hof“ stattfand. Lindaus Initiative erzielte den gewollten Effekt: Seine Gesellschaft wurde zum Kern einer katholischen Gruppierung in Heidelberg, die sich im eklatanten Widerspruch zum vorherrschenden protestantisch-liberal geprägten Zeitgeist verstand. Das von der liberalen badischen Regierung in Karlsruhe durchgesetzte Schulgesetz vom 29. Juli 1864 führte zum endgültigen Konflikt: Die Katholische Kirche fürchtete um ihren Einfluss auf die Schulen und lief unter Berufung auf die Freiheit des Gewissens Sturm gegen die geplante staatliche Kontrolle.
In Lindaus Kasino entstand der Plan, sich künftig nicht nur in Heidelberg zu treffen und auszutauschen. „Wandernde Kasinos“ waren die Antwort! In aller Öffentlichkeit sollte sich die katholische Bevölkerung bei (je nach Region) Bier oder Wein nicht nur über ihre Themen besprechen, sondern letztlich für die katholische Sache politisch mobilisiert werden. Das erste auswärtige Kasino fand am 5. Februar 1865 in Mosbach statt. In der Morlockschen Bierbrauerei strömten die Menschen zusammen und hörten mit Begeisterung dem großartigen Redner Lindau zu. Am nächsten Tag kamen bereits bis zu 2.000 Menschen in Tauberbischofsheim zusammen. In den nächsten Tagen folgten im ganzen Großherzogtum fast täglich neue Kasinos, meist mit Lindau als gefeiertem Redner.
Die Liberalen begannen nervös zu werden. In Radolfzell und andernorts versuchten sie das Kasino zu stören. Geradezu dramatisch verlief das Mannheimer Kasino am 23. Februar. Nachdem die Veranstaltung verboten worden war, überfielen Gegendemonstranten einen von Lindau angeführten Zug von rund 3.000 Teilnehmern. Trotz mehrerer Verletzter griff die Polizei nicht ein. Der „Mannheimer Kasinosturm“ sorgte in ganz Deutschland für Schlagzeilen. Lindau war endgültig bekannt geworden, und die Gründung einer katholisch-konservativen Oppositionspartei nahm Formen an.
Zum Weiterlesen und -forschen:
- Michael Kitzing: Für den christlichen und sozialen Volksstaat. Die Badische Zentrumspartei in der Weimarer Republik (= Beiträge zur Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien, Bd. 163.). Düsseldorf 2013.
- LEO-BW: Jakob Lindau.
/// Was passiert, wenn Gabi, Ahmet, Piet, Lea und Werner die Arbeit niederlegen, lesen Sie morgen in unserem Onlinekalender.