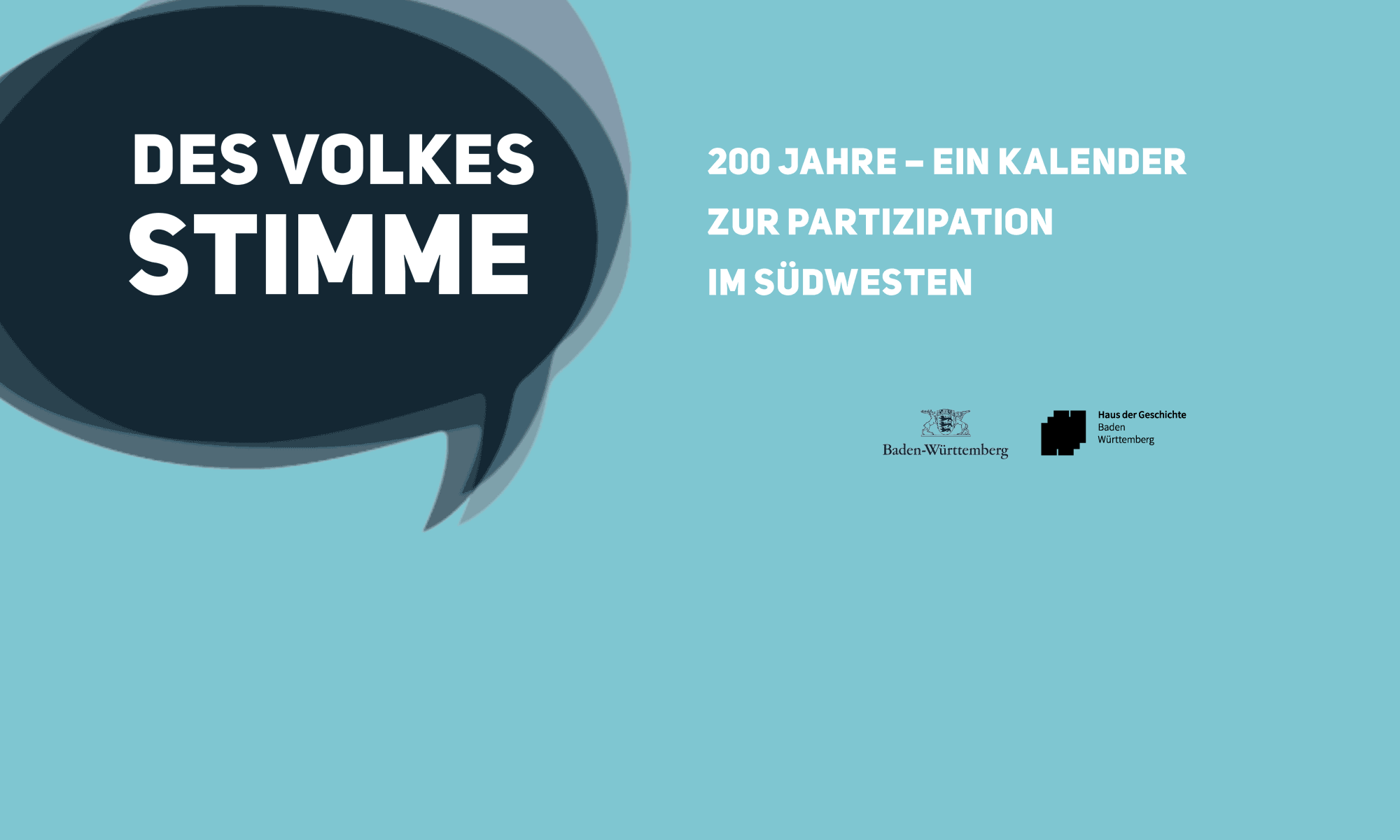28. Februar 1900 | Kommt ein Mann zur Ärztin: „Frau Doktor, Sie haben doch studiert, vielleicht können Sie mir weiterhelfen?“ – Den Witz kennen Sie anders? Es ist doch stets ein männlicher Akademiker, der sich mit den Nöten seiner Mitmenschen herumschlagen muss, oder? Im Humor bildet sich grundlegender gesellschaftlicher Wandel bisweilen recht spät ab, was sich besonders am zotenhaften Altherrenwitz zeigt. Ganz ohne Flachs: Im Jahr 2018 hatten bereits rund 30 % aller weiblichen Einwohner Deutschlands zwischen 30 und 34 Jahren einen Hochschulabschluss (Männer: 27 %) und etwas weniger als die Hälfte der rund 360.000 Studierenden in Baden-Württemberg waren im Wintersemester 2016/17 weiblich. An dritter Stelle der bei Frauen beliebtesten Studiengänge rangierte Medizin (der Frauenanteil lag hier bei 63 %).
Es verwundert nicht, dass Frauen ihr Recht auf ein Studium mühselig erkämpfen mussten. Mit der Einrichtung des ersten Gymnasiums für Frauen in Karlsruhe im Jahre 1893, war der Bildungshunger ihrer Absolventinnen wie Rahel Goitein (verh. Straus) und Johanna Kappes (verh. Worminghaus) noch lange nicht gestillt. Beide erwarben 1899 ihr Abitur.
Kappes begeisterte sich für Medizin. Durch energischen Nachfragen bei Freiburger Professoren erkämpft sie sich das Recht, als Gasthörerin an den Vorlesungen teilzunehmen. Bestärkt durch den „Verein Frauenbildung – Frauenstudium“ bittet Johanna Kappes in einem mutigen Brief an den Freiburger Senat um eine Vollzulassung. Vor Ort wird ihre Petition abgelehnt, doch das Badische Ministerium der Justiz, des Kultus und des Unterrichts verkündet in einem Erlass vom 28. Februar 1900, das die Universitäten fortan Studienanwärterinnen offen stehen. Als erste Studentin Deutschlands kann Kappes nach vier Jahre ihr Studium mit einer Promotion krönen und betreibt später als Ärztin eine Gemeinschaftspraxis mit ihrem Ehemann in Nürnberg.

Rahel Straus schrieb sich im Jahre 1900 für ein Medizinstudium an der Universität Heidelberg ein und gehörte im folgenden Jahr der Vereinigung studierender Frauen Heidelberg an. Nach ihrer Promotion im Jahre 1907 eröffnete sie in München eine gynäkologische Praxis.
Die akademische Landschaft in Deutschland ist seit den ersten Studentinnen weiblicher geworden, auch wenn beispielsweise Professuren noch immer lediglich zu rund 25 % mit Frauen besetzt sind und in zahlreichen naturwissenschaftlich-technischen Berufen Studentinnen selten anzutreffen sind. Die alten Griechen setzten andere Maßstäbe: Mit Athena, der Göttin der Weisheit und den Musen lag das Bildungsressort fest in weiblicher Hand. Das muss ja kein antiker Mythos bleiben.
Zum Weiterlesen und -forschen:
- Eva Voss: Frauen in der Wissenschaft an der Universität Freiburg, Freiburg 2007.
- Universität Heidelberg: Die ersten Studentinnen in Heidelberg.
- Marianne Koerner: Auf fremdem Terrain. Studien und Alltagserfahrungen von Studentinnen 1900-1918, Bonn 1997.
- Statistik BW: Zahl der Frauen an den Hochschulen steigt (2018).
/// Freisinnig blättern wir morgen in alten Zeitungen und fördern Fortschrittliches zu Tage.