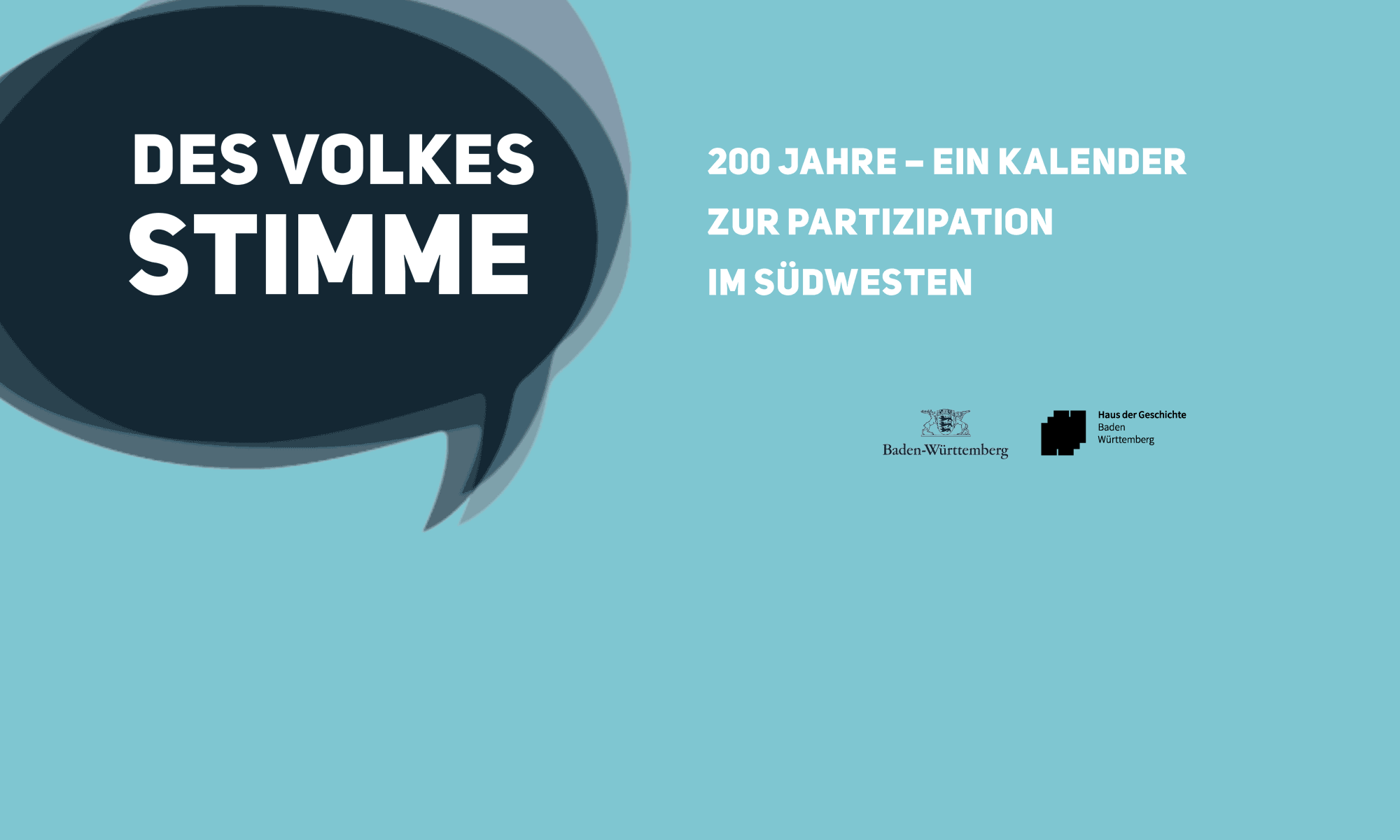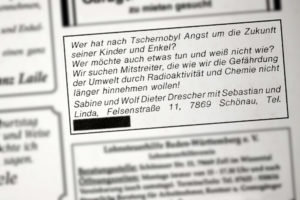25. Mai 2014 | Ein Kreuzchen auf einem Wahlzettel zu machen ist kinderleicht, oder? Zumindest Jugendlichen ab 16 Jahren traute die grün-rote Landesregierung die nötige Reife zu, als sie am 11. April 2013 das Gesetz zur Absenkung des aktiven Wahlalters in Baden-Württemberg auf den Weg brachte. Fünf Tage später trat die Änderung der Gemeindeordnung in Kraft, sodass die Jugend bereits im Folgejahr, am 25. Mai 2014, an die Urnen schreiten durfte. Doch das Recht auf Mitbestimmung blieb auf die Kommunalwahlen beschränkt und die Möglichkeit, aktiv für einen Sitz im Gemeinderat zu kandidieren (passives Wahlrecht), sah die geänderte Gemeindeordnung nicht vor.
Für die Wiedergabe des YouTube-Videos auf den Play-Button klicken. Dadurch erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt werden. Mehr Informationen und die Datenschutzerklärung von Google finden Sie unter https://policies.google.com/privacy?hl=de.
Im Vorfeld wurde über Sinn und Unsinn des aktiven Wahlrechts ab 16 Jahren umfassend diskutiert. Die Gegner des Anliegens führten Argumente ins Feld, dass Jugendliche sich noch nicht der Tragweite ihrer politischen Entscheidung bewusst seien oder dass sie verstärkt radikalen Parteien ihre Stimme geben würden. Gemäßigt-kritische Personen gaben zu bedenken, dass mit den Jugendgemeinderäte in verschiedenen Kommunen bereits die Chance gegeben sei, dass junge Menschen unter 18 Jahren ihre Anliegen und Interessen demokratisch legitimiert vertreten könnten. Prinzipiell sei dies richtig, allerdings gäbe es die parlamentarische Vertretung junger Menschen nicht flächendeckend, hielten die Befürworter des Wahlrechts ab 16 entgegen. Man solle der Jugend überhaupt mehr zutrauen, sie frühzeitig an der Gestaltung jener Gesellschaft teilhaben lassen, in der sie leben werden (und in der junge Auszubildende bereits Steuern zahlen).
Die Ergebnisse der Kommunalwahlen vom 25. Mai 2014 zeigten, dass die jungen Wählerinnen und Wähler weder besonders radikal noch auffällig häufiger wählten als die Über-18-Jährigen. „Verschwende deine Jugend“, forderte die Elektroband D.A.F in den 80er-Jahren – zumindest ihr Stimmrecht klammern zahlreiche Jugendliche heute vom Verschwenden aus.
Zum Weiterlesen und -forschen:
- Wählen ab 16: Informationsseite.
- Landeszentrale für politische Bildung: Wählen ab 16 in Baden-Württemberg, historischer Abriss, Erfahrungen, Pro und Contra.