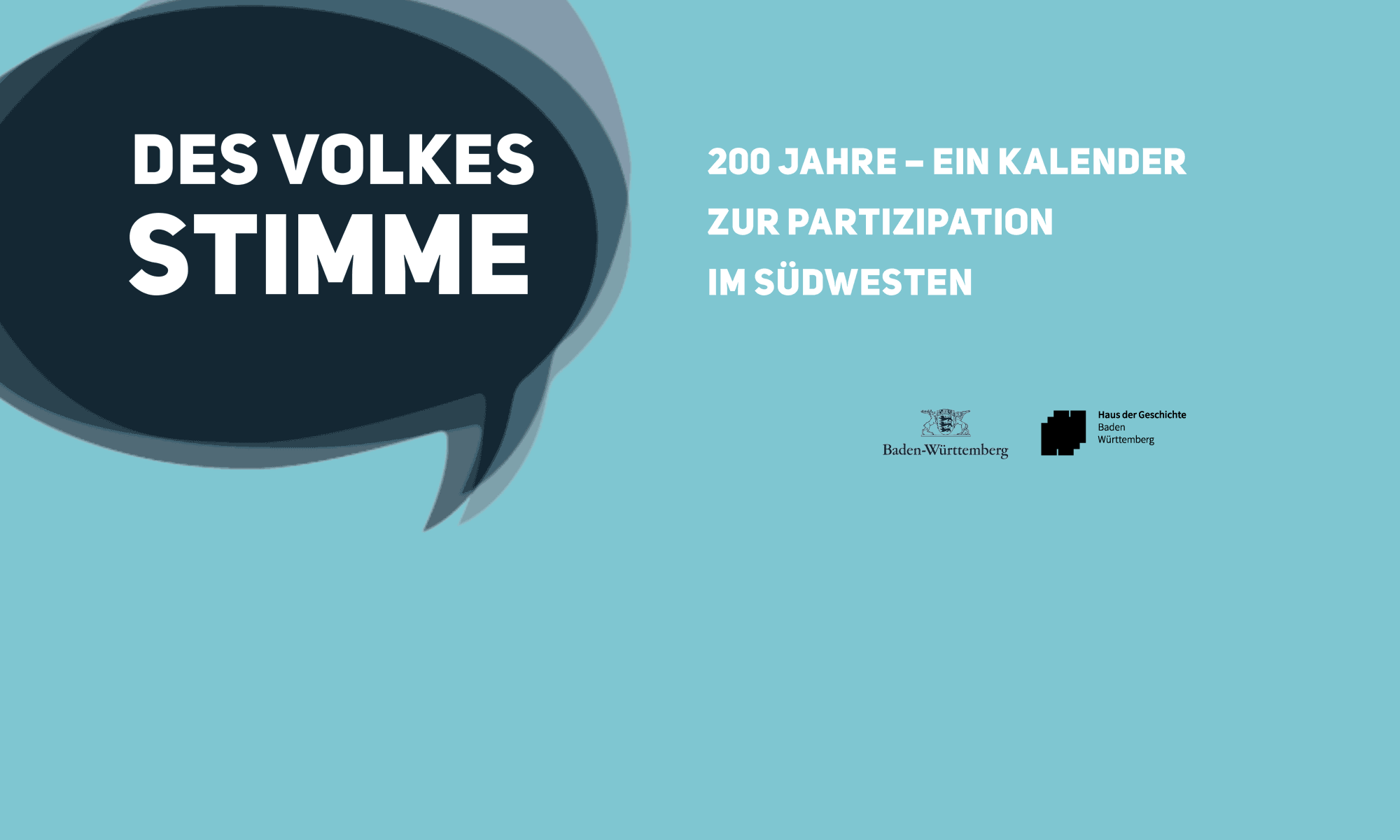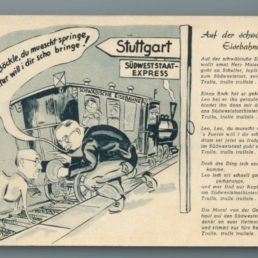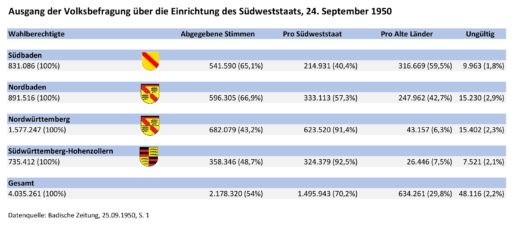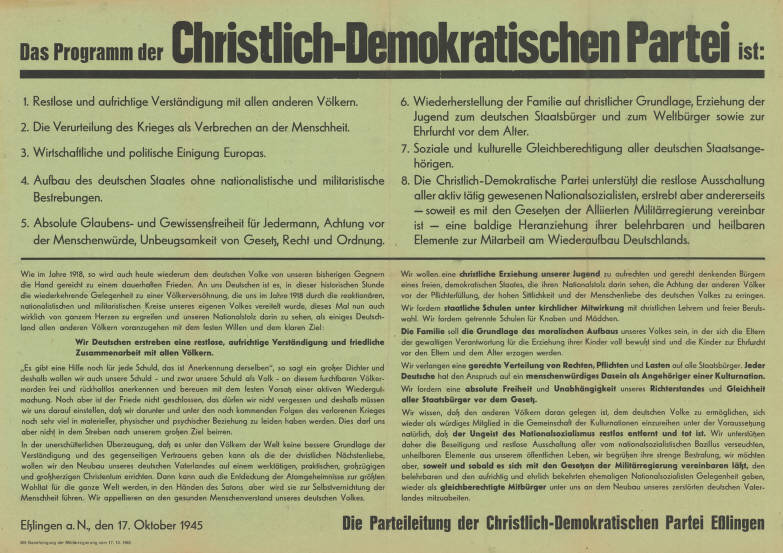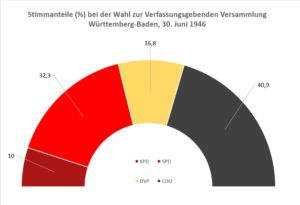15. Januar 1989 | Gerne bezeichneten sie sich als „Exoten“, die mitten in und mit der deutschen Mehrheitsgesellschaft lebten, arbeiteten, liebten, lachten, stritten und sich vertrugen. Sie kamen aus Italien, Spanien, Jugoslawien, Griechenland, der Türkei, aus dem Iran; sie suchten Arbeit, Schutz vor politischer und religiöser Verfolgung, ein Leben in Würde und Freiheit. Traditionelle ArbeiterInnenviertel wie der Stuttgarter Osten wurden ab den 1960er Jahren zu einer zweiten Heimat für die EinwandererInnen. Dabei war es nicht immer leicht gewesen, wie die türkischstämmige Leyla Süngerli aus eigener Erfahrung zu berichten weiß: Ende der 1980er Jahre suchte sie mit ihrem Kind eine Sozialwohnung in Stuttgart und geriet an einen korrupten Beamten des Wohnungsamtes, der sich an der Wohnungsnot unter den EinwanderInnen systematisch bereicherte. Mutig deckte sie gemeinsam mit einem Redakteur der migrantischen „Stuttgarter Kanaken-Zeitung“ und weiteren HelferInnen diesen Missstand auf, der deutschlandweit Empörung auslöste. Nicht zuletzt diese Aktion bestärkte das Selbstbewusstsein der lokalen Migrantenszene und bildete die Grundlage für den nächsten Schritt, wie Shahla Blum anmerkte: EinwanderInnen sollten auch in der Kommunalpolitik endlich ernst genommen werden und in die Parlamente gewählt werden können.

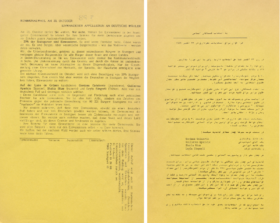
Diesem Ziel verschrieb sich eine bunte Gruppe migrantischer und deutscher Aktivisten aus der Landeshauptstadt, die am 15. Januar 1989 als „Initiative EinwanderInnen ins Rathaus“ in das Licht der Öffentlichkeit trat. Rund 150 Menschen mit verschiedenen Pässen versammelten sich im „Theaterhaus“ diskutierten mit der Türkin Sevim Çelebi, der ersten Migrantin in einem deutschen Landesparlament (Westberlin). Am Ende der Veranstaltung stand eine Erklärung, die allgemein das Wahlrecht für alle in Deutschland lebende Menschen – unabhängig von Herkunft und Pass – einforderte, unter anderem für über 80.000 EinwanderInnen in Stuttgart.
Hinsichtlich der Kommunalwahlen im Herbst 1989 wollten die Aktiven konkret erreichen, dass EinwanderInnen mit deutschen Pass auf „wirklich sichere Listenplätze“ gesetzt werden, erinnert sich Harald Stingele, damals in der Wählerinitiative aktiv. Die Stuttgarter Grünen hatten beschlossen, auf die ersten 15 Plätzen ihrer Wahlliste zwei MigrantInnen mit deutschem Pass zu setzen – einige Mitglieder der Initiative „EinwanderInnen ins Rathaus“ kritisierten diese Entscheidung als „Alibi“ und zu unsicher. Letztendlich setzte die Basis der Grünen bei der endgültigen Aufstellung der Liste ein klares Signal: Initiativenmitglied Gordana Golubović wurde auf Platz 1 gewählt, Guillermo Apericio auf den zehnten und Shahla Blum auf den elften. Auch Leyla Süngerli wurde auf die Liste gesetzt.
Man wolle das „Sprachrohr der Migranten in Stuttgart“ werden, wie Shahla Blum das Ziel der Wählerinitiative zusammenfasste. Mit vielbeachteten Aktionen wie dem „Tag der deutschen Vielheit“, einem bunten Fest der Nationen im „Theaterhaus“ (Juni 1989), Umfragen unter den EinwanderInnen und Gesprächsrunden wirbelten die Mitglieder der Wahlinitiative den Wahlkampf auf und setzten gesellschaftliche Ausrufezeichen.
Der Ausgang der Kommunalwahl vom 22. Oktober 1989 – die Grünen errangen mit 12,4% der gültigen Stimmen sieben Sitze im Gemeinderat – ermöglichte Gordana Golubović und Shahla Blum die Möglichkeit, den Forderungen, Ideen und Projekten der migrantischen Bewegung in der Landeshauptstadt politisches Gewicht zu verleihen.
Nicht zuletzt der Arbeit solcher Gruppen wie der „Initiative EinwanderInnen ins Rathaus“ ist es zu verdanken, dass die kurdischstämmige Muhterem Aras heute Präsidentin des baden-württembergischen Landtags ist. Doch gibt es in Sachen Gleichberechtigung, Integration und Teilhabe von EinwanderInnen noch immer viel zu tun.
Zum Weiterlesen- und forschen:
- Forum der Kulturen Stuttgart: Homepage.