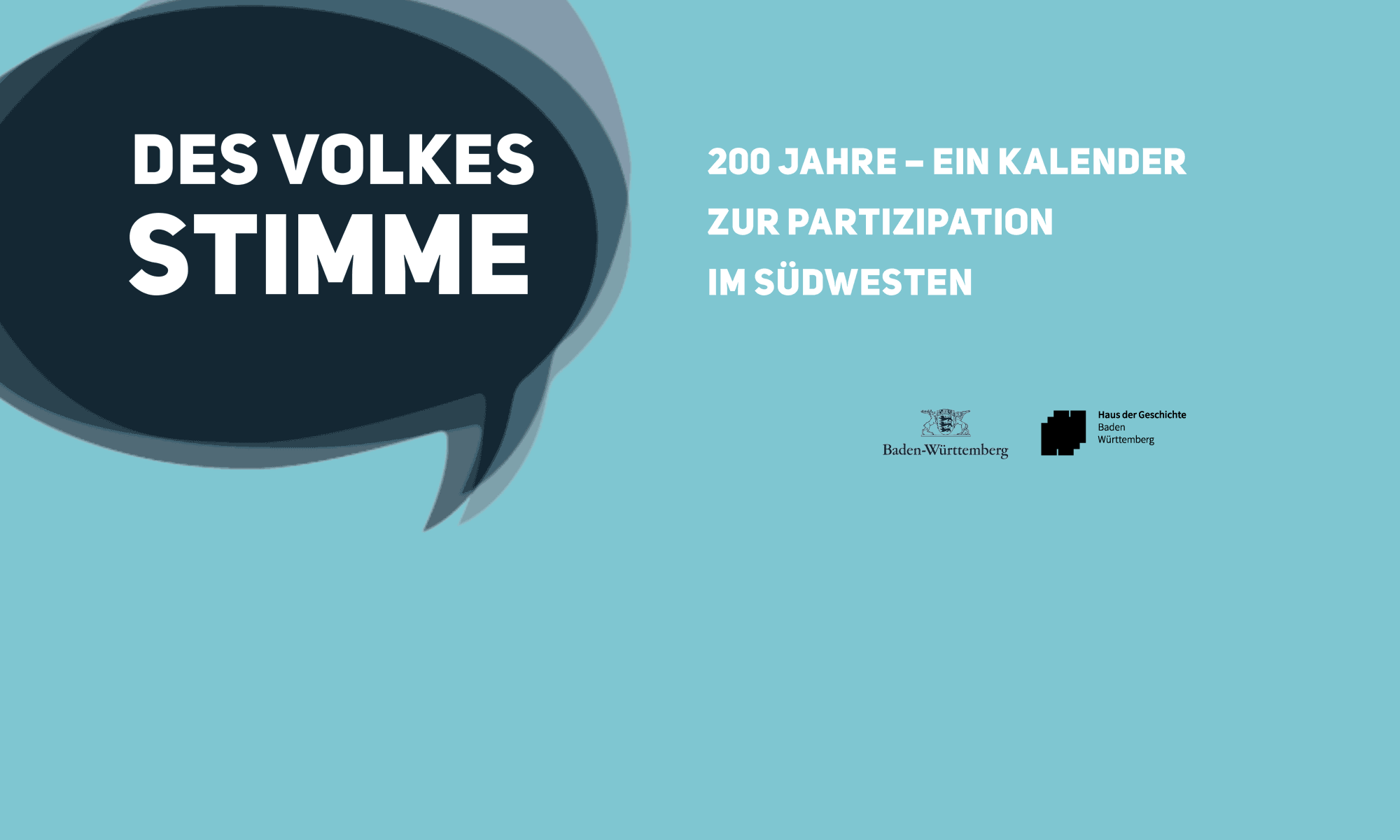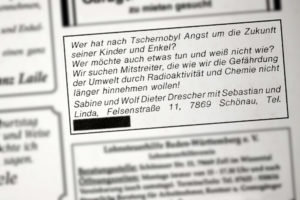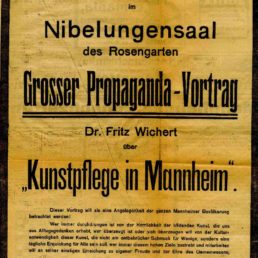23. Mai 1948 | Grundlegendes wurde vor 70 Jahren verabschiedet: das Grundgesetz (GG) der Bundesrepublik Deutschland. Zunächst nur als Provisorium gedacht, hat es sich bis heute seine Gültigkeit bewahrt und bislang bestens bewährt. Seine Entstehungsgeschichte in der unmittelbaren Nachkriegszeit ist eng mit dem Verfassungskonvent im bayrischen Schloss Herrenchiemsee verbunden, der im August 1948 einberufen worden war. Gerne werden die Bevollmächtigten der elf westdeutschen Länder „Väter des Grundgesetzes“ genannt – da Frauen nicht anwesend waren, konnte von „Müttern“ ja leider keine Rede sein. Hier wurden grundsätzliche Formulierungen diskutiert und dem Parlamentarischen Rat ein Verfassungsentwurf zur weiteren Diskussion und Abstimmung überreicht. Am 23. Mai 1949 wurde das GG sodann verkündet, das mit dem Beginn des 24. Mai in Kraft trat.

Die drei südwestdeutschen Bevollmächtigten auf Herrenchiemsee 1948 waren höchst unterschiedliche Männer: Für Württemberg-Baden saß der Staatsminister der Justiz, Josef Beyerle, am Tisch; Württemberg-Hohenzollern wurde durch den stellvertretenden Staatspräsidenten und Justizminister Carlo Schmid vertreten; und für Baden war der Präsident des Oberlandesgerichts Freiburg, Paul Zürcher, gekommen. Heute ist sein Name weithin unbekannt. Dabei lohnt es sich, an ihn zu erinnern.
Der 1893 in Sunthausen (heute Ortsteil von Bad Dürrheim) geborene Zürcher hatte nach dem Ersten Weltkrieg eine juristische Karriere begonnen und war bis 1944 Amtsgerichtsrat in Freiburg gewesen. Bereits 1935 stand er auf einer Liste von Justizbeamten, die wegen abweichender politischer Meinung versetzt werden sollten. Zürcher behielt seinen Posten, legte sich allerdings in den Jahren 1939/40 mit dem NS-Machtapparat an. Er weigerte sich vehement, die ihm vorgeschriebene Austragung des Freiburger katholischen Studentenvereins Normania aus dem Vereinsregister vorzunehmen. Die Gestapo habe das Verbot rechtswidrig vorangetrieben, so Zürchers Standpunkt. Seine Widerspenstigkeit hatte zur Folge, dass der Jurist im Jahre 1944 als Rüstungsarbeiter zwangsverpflichtet wurde. Nach der Befreiung beteiligte er sich maßgeblich am Aufbau der Badisch Christlich-Sozialen Volkspartei (dem badischen Vorläufer der CDU). Als ausgewiesener Fachmann – 1945 war er zunächst Leiter der Justizverwaltung in der französischen Besatzungszone Baden geworden – empfahl er sich für das Verfassungskonvent auf Schloss Herrenchiemsee. Hier war er vor allem als Vorsitzender des Unterausschusses III für Organisationsfragen (Aufbau, Gestaltung und Funktion der Bundesorgane) tätig.
Paul Zürcher ist somit nicht nur Teil der deutschen Verfassungsgeschichte, sondern auch der Geschichte des Widerstandes gegen die NS-Diktatur im Südwesten. Das digitale Gedenkbuch des Landtags Baden-Württemberg listet weitere ParlamentarierInnen mit diesem Hintergrund auf.
Zum Weiterlesen und -forschen:
- Das digitale Gedenkbuch des Landtags Baden-Württemberg: Eintrag zu Paul Zürcher.
- Angela Borgstedt: Paul Zürcher. Amtsgerichtsrat in Freiburg, in: Heiko Maas (Hg.): Furchtlose Juristen. Richter und Staatsanwälte gegen das NS-Unrecht, München 2017, S. 266-277 u. S. 325-326.
- Landeszentrale für Politische Bildung Baden-Württemberg: 70 Jahre Grundgesetz.